Suche

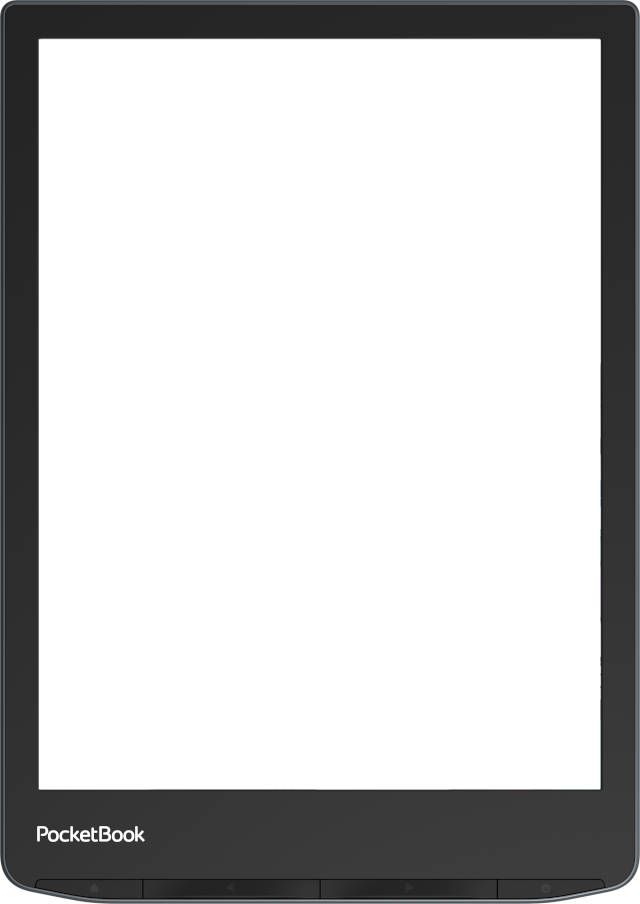
Das verborgene Genie
Roman | Marie Benedict
E-Book (EPUB)
2024 Verlag Kiepenheuer & Witsch Gmbh
Auflage: 1. Auflage
352 Seiten
ISBN: 978-3-462-31025-2
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages
- Als Taschenbuch erhältlich
Marie Benedict widmet sich einer weiteren klugen Frau, die die Weltgeschichte entscheidend geprägt hat und deren Namen wir dennoch nicht kennen. Rosalind Franklin fand nach jahrelanger Forschung die Doppelhelixstruktur unserer DNA, doch für diesen Coup geehrt wurden fälschlicherweise drei Männer. Rosalind Franklin war schon immer eine Außenseiterin - brillant, aber anders. Sie fühlt sich der Wissenschaft am nächsten, den unveränderlichen Gesetzen der Physik und Chemie, die ihre Experimente leiten. Sie wird beauftragt, das Geheimnis unserer DNA zu entschlüsseln. Rosalind weiß, dass, wenn sie nur eine weitere Röntgenaufnahme macht - eine weitere nach Tausenden -, sie die Bausteine des Lebens enträtseln kann. Nie wieder wird sie sich die Beschwerden ihrer Kollegen anhören müssen, insbesondere die von Maurice Wilkins, der lieber mit James Watson und Francis Crick über Genetik konspiriert, als mit ihr zusammenzuarbeiten. Dann ist es endlich so weit - die Doppelhelixstruktur der DNA offenbart sich ihr in vollkommener Klarheit. Doch was dann folgt, hätte Rosalind niemals vorhersehen können.
Marie Benedict, geboren 1973, studierte am Boston College Geschichte und Kunstgeschichte und an der Boston University School of Law. Ihre Bücher über starke Frauen der Weltgeschichte haben Bestsellerstatus. Ihr Roman »Frau Einstein« verkaufte sich über 100.000 Mal allein in Deutschland. Sie ist Anwältin und lebt mit ihrer Familie in Pittsburgh.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
Kapitel 1
3. Februar 1947
Paris
Ein dünner Nebel hängt über der Seine in der frühen Morgenluft. Seltsam, denke ich, diese blaugrünliche Färbung. Ganz anders als der gelbe Dunst über der trüben Themse daheim in London. Könnte es sein, dass der Dunstschleier - der ja leichter ist als Nebel, eine geringere Dichte hat, weil er weniger Wassermoleküle enthält - vielleicht das klarere Wasser der Seine reflektiert? Staunend betrachte ich das Zusammentreffen von Himmel und Wasser, in dem die Türme von Notre-Dame zwischen dünnen Wolkenfetzen herausragen, auch im Winter ein atemberaubendes Schauspiel. Das Himmelreich berührt die Erde, würde Papa sagen, aber ich glaube an die Wissenschaft, nicht an Gott.
Ich schüttle die Gedanken an meine Familie ab und versuche, mich ganz dem Spaziergang von meiner Wohnung im sechsten hinunter ins vierte Arrondissement hinzugeben. Je weiter ich komme, desto spärlicher gesät sind die Cafés an der Rive Gauche mit ihren Tischen auf den Gehsteigen, die selbst an einem frühen Februarmorgen gut besucht sind, und als ich den Fluss schließlich überquere, gelange ich in die geordnete, elegante Welt der Rive Droite. So unterschiedlich sich die beiden Arrondissements auch geben, tragen sie beide doch noch immer Narben aus dem Krieg, viele Gebäude sind beschädigt, die Bewohner noch immer auf der Hut. Bei uns ist es nicht anders, auch wenn in Paris offenbar die Menschen mehr von der Wucht des Krieges abbekommen haben als die Häuser; vielleicht sitzt ihnen ja auch immer noch das Schreckgespenst der Nazibesatzung im Nacken.
Eine unerhörte, verstörende Frage kommt mir in den Sinn, eine Frage, die sich wohl kaum wissenschaftlich ergründen lässt. Als die Nazis unschuldige Franzosen und unbescholtene Juden erschossen - schlugen da möglicherweise Moleküle der deutschen Soldaten über die Gewehrkugeln durch die Opfer hindurch? Ist Paris vielleicht nicht nur von physischen Überresten des Krieges gezeichnet, sondern zugleich durchsetzt von mikroskopisch kleinen wissenschaftlichen Relikten der Feinde und Opfer, auf eine Weise miteinander verschmolzen, die bei den Nazis pures Entsetzen hervorrufen würde? Würden sich die Überreste von Deutschen und Juden bei näherer Betrachtung am Ende gar als identisch erweisen?
Diese Art der Fragestellung hatte der französische Physiker Jean Perrin wohl kaum vor Augen, als er 1926 für den Nachweis der Existenz von Molekülen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Unvorstellbar, denke ich kopfschüttelnd, dass noch vor zwanzig Jahren umstritten war, ob es das Subuniversum, das heute meine gesamte Arbeit ausmacht, überhaupt gibt.
Als ich mich dem Laboratoire Central des Services Chimiques nähere, bleibe ich stehen. Ich bin verwirrt. Das soll das ehrwürdige Chemie-Institut sein? Das Gebäude hat zwar durchaus Patina, aber die Ehrbarkeit und Erhabenheit, die ich von einer Institution erwartet hätte, in der eine derart herausragende innovative Forschung betrieben wird, strahlt es nicht gerade aus. Das hier könnte genauso gut ein x-beliebiges Regierungsgebäude irgendwo auf der Welt sein. Als ich die Stufen zum Haupteingang hinaufsteige, kann ich förmlich hören, wie Papa an meiner Entscheidung herummäkelt: Deine harte Arbeit und dein Engagement für die Wissenschaft sind ja lobenswert, hatte er gemeint, aber warum musst du ausgerechnet nach Paris gehen, warum ausgerechnet in eine Stadt, die noch immer mit den Folgen der Besatzung und der schrecklichen Verluste zu kämpfen hat? Warum ausgerechnet in eine Stadt, in der die Nazis - das Wort auszusprechen, hatte ihn sichtlich Mühe gekostet - geherrscht und überall Spuren ihres Grauens hinterlassen haben? Es verlangt mir einiges ab, Papa wieder aus meinen Gedanken zu verscheuchen.
»Bonjour«, begrüße
